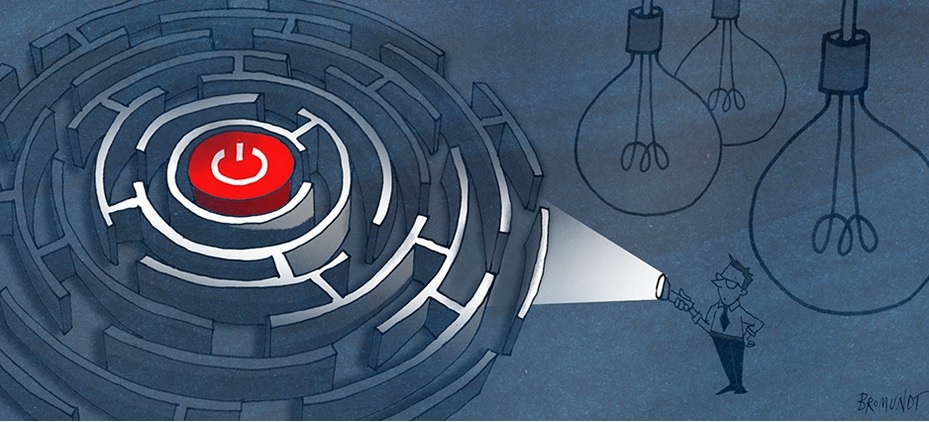Die Arbeit an einer nachhaltigen Energiezukunft darf nicht den Ideologen überlassen werden. Die Verfassung verlangt nicht nur eine ökologische, sondern auch eine ausreichende, breit gefächerte, sichere und wirtschaftliche Energieversorgung. Im Zentrum der politischen Diskussion muss daher das derzeit technisch Machbare stehen. Anbei meine letzte Kolumne für das Universitätsmagazin HSG Focus.
Haben Sie schon eine sachliche Diskussion über die Energiewende erlebt?
Der Begriff «Betonköpfe» gehört zum Standardvokabular in Diskussionen über Energiepolitik. Gemeint sind starrköpfige Menschen, die uneinsichtig auf ihren Ansichten beharren. Menschen, die die Zukunft nicht sehen wollen oder nicht sehen können – die nicht begreifen, dass sich die Welt geändert hat und dass sie sich ebenfalls ändern müssten. Der Ausdruck ist eine Ausrede, um sich nicht mit der Meinung anderer Leute auseinandersetzen zu müssen. Wer sich jedoch sachlichen Argumenten entzieht, indem er seinem Gegenüber Dummheit oder amoralisches Verhalten vorwirft, dem sollte man vielleicht etwas genauer auf die Finger schauen.
Das Thema Energie steht völlig zu Recht im Zentrum der aktuellen Ausgabe von «HSG Focus». An unserer Universität beschäftigen sich 45 Forscherinnen und Forscher an fünf Instituten sehr intensiv und aus verschiedenen Perspektiven mit Energie. Die sachlich-konstruktiven Diskussionen in diesem Rahmen zeigen mir vor allem: Was Enthusiasten und Skeptiker der Energiewende trennt, sind in erster Linie unterschiedliche Wahrnehmungen der Zukunft sowie unterschiedliche Einstellungen gegenüber Risiken und staatlicher Steuerung. Die einen mahnen: «Das machen wir erst, wenn 1. … 2. … 3. … gegeben sind!» Die anderen halten dagegen: «Das machen wir, obwohl 1. … 2. … 3. … noch nicht realisierbar sind.»
Es geht also um Wertentscheide, die jeder Mensch für sich treffen muss und die durchaus unterschiedlich ausfallen dürfen. Den Skeptikern der Energiestrategie kann daher nicht generell das Label «Betonköpfe» verpasst werden – jedenfalls solange nicht ehrlich versucht wurde, deren berechtigte Zweifel auszuräumen. Diskussionsscheue betonköpfige Ideologen finden sich leider auf allen Seiten des energiepolitischen Schützengrabens. Unter der Diskussionsverweigerung leidet vor allem die Suche nach sachgerechten Lösungen für eine nachhaltige Energiezukunft.
Einzelne Erfolge sollten den Blick auf die Rahmenbedingungen nicht verstellen
Die derzeit reichlich fliessenden Forschungsgelder im Energiebereich erhöhen den Druck zur öffentlichen Kommunikation von bahnbrechenden Resultaten. So werden wir mit Medienmitteilungen über effizientere Solarzellen, intelligentere Netze und preisgünstigere Batteriespeicher förmlich überschwemmt. Die vielen Bäume lassen den Blick auf den Wald aus den Augen verlieren. Der Wald, das ist ein komplexes Geflecht aus technisch-physikalischen Grenzen sowie nationalen und internationalen Rahmenbedingungen.
Die grosse Reform des Elektrizitätsmarktes im Jahr 2007 wurde vorgenommen, um diesem monopolistischen Bereich etwas Wettbewerb einzuhauchen. Die Liberalisierung (oder Re‑Regulierung) basierte auf einer in den Telekommunikationsmärkten erfolgreich getesteten ökonomischen Theorie: Eine Entbündelung von Netzanschlussleistung einerseits und Elektrizitätserzeugung und -versorgung andererseits soll zu Wettbewerb in den Märkten führen, die dem Netz vor- und nachgelagert sind. Leider hat der Gesetzgeber nicht bedacht, dass ökonomische Modelle nicht zwingend mit der realen Welt übereinstimmen. Die Telekommunikation unterscheidet sich in ganz wesentlichen Aspekten von den Elektrizitätsmärkten. So finden sich in der Telekommunikation parallele Netzinfrastrukturen, ganz im Gegensatz zu den Elektrizitätsmärkten. Zudem muss Elektrizität zeitgleich erzeugt und konsumiert werden, das Netz und die Produktion sind gegenseitig substituierbar und die Strukturen der Branche sind eng verflochten. Diese Faktoren lassen das gängige ökonomische Modell nicht als gute Grundlage für eine Regulierung erscheinen.
Die heutigen Rahmenbedingungen müssten an sich unter Aspekten des Regulierungsversagens diskutiert werden, werden aber nun durch die angestrebte «Energiewende» verkompliziert. Dabei scheinen sich die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen: So zitiert die bundesrätliche Botschaft für die gesamten Modellrechnungen zur Energiestrategie vornehmlich die Studie eines einzigen kommerziellen Anbieters. Dessen Resultate müssen freilich nicht falsch sein. Doch erscheinen damit die ökonomischen Grundlagen der Energiestrategie kaum als robust, und angesichts der realen Schwierigkeiten beim Ausbau von Windkraft, Wasserkraft und Geothermie auch kaum noch als aktuell. Nach den Beschlüssen des Ständerates vom 23. September 2015 zur Energiestrategie ist zudem mehr denn je unklar, wohin die Energiewende denn hinwenden soll: Ist das Ziel der «Atomausstieg», die Senkung der CO2-Emissionen, beides gleichzeitig oder gar nichts (mehr) davon?
Selbst wer als «Ziel» der Energiewende nur die gesetzlichen «Richtwerte» für die Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren Energien zum Massstab nimmt, wird sich fragen müssen, ob dieser Ausbau mit den dafür bereitgestellten finanziellen Mitteln überhaupt erreichbar ist. Skepsis ist angebracht, weshalb die zukünftige Stromlücke wohl einfach mit Importen geschlossen werden wird. Diese stammen aber entweder aus zweifelhaften (z.B. Kohle) oder dann aus hochsubventionierten Quellen (Solar und Wind). In anderen Konstellationen würden solch subventionierte Exporte, welche die Schweizer Wasserkraft in grosse Bedrängnis bringen, zu Recht mit welthandelsrechtlichen Retorsionsmassnahmen bekämpft. In der Schweiz antwortet die Politik auf diese wettbewerbsverzerrenden Subventionen lieber mit einer Ausweitung der eigenen Subventionsmaschine.
Nur schon etwas Jonglieren mit dem Taschenrechner zeigt: Da geht etwas ganz und gar nicht auf
Gemäss Verfassung soll die schweizerische Energieversorgung nicht nur umweltfreundlich, sondern auch ausreichend, breit gefächert, sicher und wirtschaftlich sein. Die Energiestrategie 2050 kann diese Ziele nicht gleichermassen zum Tragen bringen, was schon ein Blick auf die ganz rudimentärsten Kennzahlen zeigt.
Im August 2015 standen gemäss dem Erläuterungsbericht zum «Konzept Windenergie» in der Schweiz 34 grosse Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt 60 MW in Betrieb; diese Anlagen produzieren mehr als 100 GWh Strom pro Jahr. Daraus ergeben sich 1667 jährliche Volllaststunden; da das Jahr aber 8760 Stunden aufweist, stehen diese Windenergieanlagen offenbar an vier von fünf Tagen still. Ähnlich düster sieht es für Photovoltaikanlagen aus: So wird das grosse Solarkraftwerk auf dem Dach der AFG Arena mit 600 kW installierter Leistung knapp 600 MWh pro Jahr produzieren. Damit produziert diese Anlage also an acht von neun Tagen keinen Strom. Darüber hinaus ist die Produktion dieser neuen erneuerbaren Energieerzeuger nicht steuerbar: Tendenziell glättet die Einspeisung von Solarstrom zwar die Nachfragespitzen zur Mittagszeit. Jedoch ist nicht sicher, ob diese Einspeisung dann wirklich kommt. Wind- und Sonnenenergie werden möglicherweise zu Zeiten ins Netz gespeist, da niemand Strom braucht; und sie sind allenfalls dann nicht verfügbar, wenn eigentlich Nachfrage bestünde.
Mit diesen Ausführungen will ich nun nicht sagen, dass diese Erzeugungsanlagen an sich oder der Produktionsausbau aus diesen Anlagen sinnlos wären. Auch rentieren die Anlagen, die Subventionen eingerechnet, für die Investoren bestens. Nichtsdestotrotz ist dem Gesetzgeber aufgetragen, bei der Gestaltung der Energiepolitik eine gesamtgesellschaftliche Sicht einzunehmen, und nicht den Angehörigen einer sich selbst als «Cleantech» feiernden Industrie üppige Renten zu Lasten der Allgemeinheit zu ermöglichen.
Mit anderen Worten können wir durchaus einen Teil der Elektrizitätsversorgung mit neuen Erneuerbaren bestreiten. Wenn Wind und Sonne aber einen grösseren Anteil der 57,5 Mrd. kWh Stromverbrauch in der Schweiz abdecken sollen (Elektrizitätsstatistik 2014), dann muss der Gesetzgeber eine robuste Vorstellung davon haben, wie die Stromnachfrage bei flauem Wind und verdeckter Sonne sichergestellt wird. Ohne einen massiven Ausbau der Grenzkuppelstellen und ohne kosteneffiziente Speichermöglichkeiten wird dies nicht möglich sein. Während der grenzüberschreitende Energiehandel jedoch aus politischen Gründen mit Unsicherheiten behaftet ist (Stromabkommen), stehen kostengünstige Speicher heute allein schon technisch nicht zur Verfügung. Zwar wurde in der Beilage «Energiezukunft» der NZZ am Sonntag vom 4. Oktober 2015 eine Batterie der EWZ bejubelt, die mit 719 kWh die grösste Kapazität in der Schweiz aufweist. Der Speicher reicht jedoch gerade aus, um die Schweiz während knapp 0,4 Sekunden mit Strom zu versorgen. Um die Schweiz nur einen ganzen Tag lang mit Batterien versorgen zu können, müssten die Versorger gut 219’000 weitere solche Batterien bauen, zu einem Gesamtpreis von etwas über 55 Mrd. Franken (die fast konkurrenzlos günstige Tesla Batterie als Referenzpreis genommen).
Der Staat darf sich nicht die Risikoneigung privater Kapitalgeber aneignen
Die Schweiz ist keine ökonomische Spielwiese. Hier wird keine ideale Elektrizitätsversorgung am grünen Tisch gebaut, sondern eine realexistierende Branche verändert. Eine Branche, die in der Vergangenheit in der Lage war, jederzeit eine gewünschte Menge an Elektrizität zu angemessenen Preisen zu liefern. Die enorme Bedeutung einer sicheren Elektrizitätsversorgung für die Schweiz zeigt sich exemplarisch darin, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz in einem Bericht vom Mai 2015 eine mehrwöchige Strommangellage als höchstes Risiko für die Schweiz bezeichnet hat. Der Gesetzgeber trägt bei Eingriffen in die Stromwirtschaft entsprechend eine grosse Verantwortung. Ganz anders als bei privatem Risikokapital darf sich der Gesetzgeber nur beschränkt ins Ungewisse vortasten; die allen Einwohnern der Schweiz auferlegten Risiken müssen überschaubar sein, was Experimente im grossen Stil verbietet. Der Ständerat mag in dieser Herbstsession die Enthusiasten einer «neuen» Energiewirtschaft arg enttäuscht haben. Betonköpfig ist er deswegen aber nicht – nur angemessen vorsichtig. Denn wer sich den Fakten nicht stellt, wird von der Realität bald eingeholt.
St.Gallen, 4. Dezember 2015